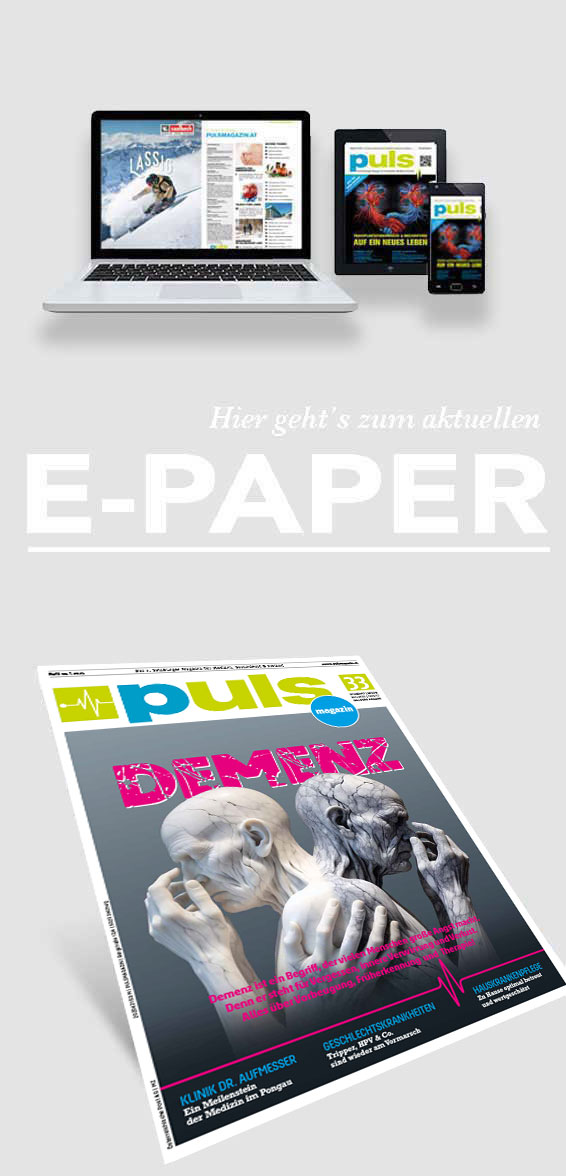Der kürzlich verübte Amoklauf in Graz durch einen 21-jährigen ehemaligen Schüler dieser Schule wirft im Nachhinein eine Vielzahl an Problemstellungen auf: Ist die Schule ein sicherer Ort? Ist die Verfügbarkeit von Waffen in Österreich zu tolerant? Kann das Schulsystem ausreichend auf Mobbing eingehen? Welche präventiven Maßnahmen sind sinnvoll und notwendig?
In unserem Schulsystem mangelt es am Bewusstsein für die Bedeutung des sozialen Lernens. Die Schule gilt nach wie vor hauptsächlich als Ort der Wissensvermittlung. Dabei sollte sie ebenso ein Ort für soziale Erfahrungen sein – insbesondere, da die Gehirnreifung in diesem Alter noch nicht abgeschlossen ist. Jugendliche sind noch wenig emotional gefestigt, vor allem wenn sie in einem konfliktreichen familiären Umfeld aufwachsen. Erfährt ein Jugendlicher Mobbing in der Klasse, stellt dies eine erhebliche psychische Belastung dar.
Aus der Opferrolle aussteigen
In meiner Praxis betreute ich ein 15-jähriges Mädchen, das unter massivem Mobbing litt und schließlich den Schulbesuch verweigerte. Das Lehrpersonal war - auch zeitlich bedingt - nicht imstande, den Konflikt zu lösen, und Schulpsychologen standen nicht zur Verfügung. Im Laufe der Therapie erkannte das Mädchen ihre eigene Resilienz und entwickelte eine Erkenntnis dafür, dass die Täter (die Mobber) selbst unter enormer Unsicherheit und Unwohlgefühlen litten, die diese in der Aggression und Abwertung des Mitschülers abwehrten. Sie lernte im psychodramatischen Rollenspiel, sich als Opfer nicht mehr zur Verfügung zu stellen und sich rechtzeitig abzugrenzen. Durch einen Schulwechsel konnte das Mädchen ihr neu gewonnenes Selbstwertgefühl zudem konstruktiv einsetzen. Positiv wirkte sich zudem der stabile familiäre Rückhalt aus.
Im Fall des Täters ist bekannt, dass auch er gemobbt wurde. Ein anschließender Schulabbruch erfolgte (jeder Abbruch ist auch ein Trauma), offenbar ohne berufliche Umorientierung oder ausreichende Unterstützung im familiären Umfeld. Durch eine geringe Frustrationstoleranz steigerten sich Hass- und Rachegedanken. Zudem verstärken sogenannte Ego-Shooterspiele die Gewaltbereitschaft und minimieren die Hemmschwelle zu töten.
Geplanter Suizid
Allgemein ist bekannt, dass gewalthaltige Computerspiele die Hemmschwelle zur Gewaltausübung minimieren. Dies wurde auch durch die Situation in der COVID-Pandemie, durch die damalige Isolation im sozialen Bereich gefördert. Im Fall des Grazer Amokläufers handelte es sich um einen geplanten erweiterten Suizid. Der Tatort war der Ort seiner erlebten Demütigung. Die Rache galt der Schule, die er abgebrochen hatte, und den Schülern, die den Abschluss schaffen (Neidkomplex).
Mit Waffen ist verantwortungsvoll umzugehen – das fordert die Gesellschaft zu Recht. Das österreichische Waffengesetz sieht seit 1997 eine psychologische Begutachtung vor. Dabei werden unter anderem Persönlichkeitseigenschaften wie emotionale Stabilität und Selbstkontrolle geprüft, um die Verlässlichkeit der Antragsteller zu beurteilen. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt zur Risikominimierung, obwohl sie keine absolute Garantie für zukünftige Stabilität bieten kann.
Warnzeichen ernst nehmen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sogenannte Amokläufer meistens männlich sind und unter enormer psychischer Belastung und erheblichem Druck stehen. Weiters steht meist eine extreme narzisstische Kränkung im Vordergrund, die mit sozialem Rückzug einhergeht. Oftmals gehen der Tat Ankündigungen im Internet („Leaking“) voraus. Die Beschaffung einer oder mehrerer Waffen verstärkt die Tatbereitschaft. In diesem Zusammenhang entstehen Gefühle von Ausweglosigkeit, kombiniert mit Hass auf die Umgebung, und ein Rache- und Geltungsbedürfnis, das über den Tod hinausgeht.
Warnzeichen in der Schule sind der soziale Rückzug eines Kindes, Leistungsabfall, psychosomatische Beschwerden, Ängstlichkeit und geringes Regelbewusstsein. Aggressives Verhalten kann als Abwehrreaktion auf Angst ebenso auftreten.
Lösungsansatz: Empathiefähigkeit steigern
Mit Regeln und sozialen Trainings gelingt es, das Schulklima zu stärken, eine Wertevermittlung und Empathiefähigkeit ist zu fördern, um so einen respektvollen Umgang untereinander herzustellen. Hierbei haben sich psychodramatische Rollenspiele mit Jugendlichen sehr bewährt. Im Rollentausch wird die jeweils andere Rolle gefühlt und dadurch das Leid des anderen erfasst. Dadurch kommt es zu einer Stärkung der Selbstreflexion.Ein wichtiges gesellschaftliches und schulisches Thema sollte auch die Vermeidung der Konsumation von Gewaltvideos sein. Diese reduzieren die Empathiefähigkeit nämlich deutlich.
Aus psychologischer Sicht ist die Förderung von gemeinsamem Sport – gemeinsame Unternehmungen, Musizieren und ähnliche Aktivitäten – zur Ausschüttung von Glückshormonen und zur Pflege der Gruppendynamik empfehlenswert. Es sollte genug Zeit und Raum zur Verfügung stehen, um einen Austausch von Gefühlen, zur Health-care und Konfliktaustragung auf Erwachsener Ebene, zu ermöglichen.