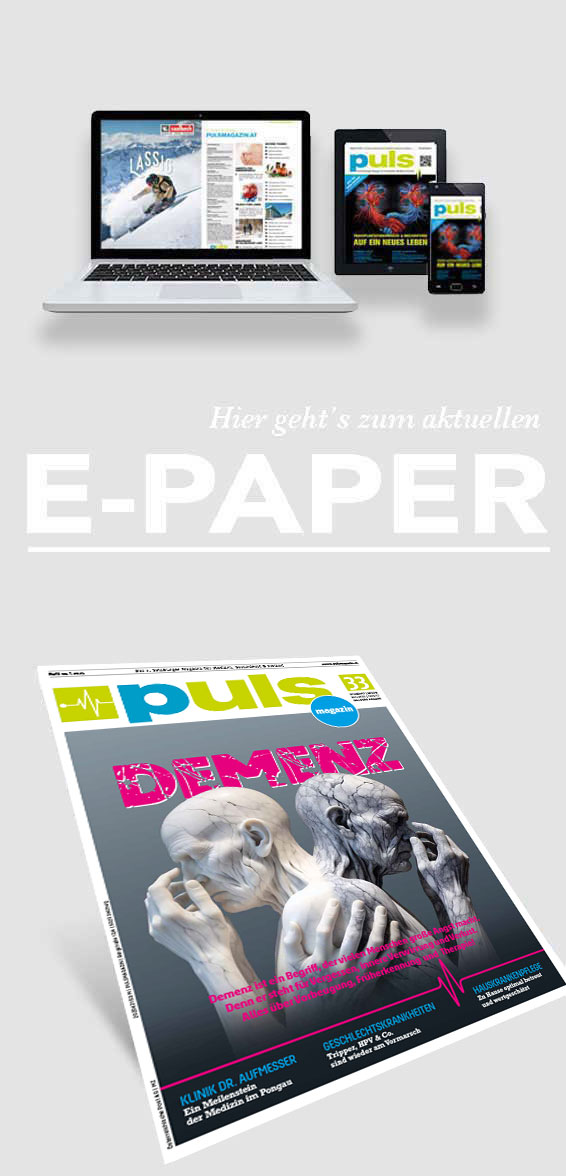Demenz ist kein einheitliches Krankheitsbild, für das es Leitfäden gibt, an die man sich halten kann, sondern lediglich ein Sammelbegriff für viele verschiedene Syndrome, bei denen die kognitiven Fähigkeiten wie das Gedächtnis, die Orientierung, die Sprache und das eigene Urteilsvermögen dauerhaft beeinträchtigt werden. Die häufigste und für uns bekannteste Form ist hierbei die Alzheimer-Krankheit. Daneben gibt es auch vaskuläre Demenzen, frontotemporale Demenzen oder die Lewy-Körperchen-Demenz. Allen gemeinsam ist, dass sie einen fortschreitenden Verlauf haben und die Betroffenen dadurch nach und nach immer mehr Unterstützung im Alltag benötigen. Doch während die Medizin hier vor allem auf die biologische Ebene schaut, wie beispielsweise auf die Ablagerungen von Eiweißstoffen im Gehirn, Durchblutungsstörungen oder genetische Risikofaktoren, gibt es eine zweite, ebenso bedeutsame Dimension. Nämlich die emotionale und soziale Erfahrung von Demenz.
Was im Gehirn geschieht und was im Herzen bleibt
Um besser zu verstehen, wie Demenz wirkt, hilft ein kurzer Blick in die Funktionsweise unseres Gehirns. Unsere Erinnerungen entstehen durch komplexe Netzwerke von Nervenzellen. Wird eine Information aufgenommen, etwa das Gesicht eines lieben Familienmitglieds oder der Duft von frisch gebackenem Kuchen in Omas Küche, bilden sich in unserem Gehirn synaptische Verbindungen. Und je häufiger diese Verbindungen dann aktiviert werden, desto stabiler werden sie.
Im Laufe einer Demenz, insbesondere bei Alzheimer, werden die Nervenzellen dann jedoch durch krankhafte Eiweißablagerungen geschädigt und sterben ab. Dadurch können ganze Netzwerke in unserem Gehirn zusammen brechen, Erinnerungen verblassen und die Orientierung zusehends verloren gehen. Das, was einst selbstverständlich war verblasst immer mehr und die Betroffenen verlieren zusehends die Verbindung zu ihrem eigenen Ich und zu ihrer Umwelt.
Emotionale Reaktionen erstaunlich lange stabil
Doch nicht alle Bereiche des Gehirns sind dabei gleich betroffen. Besonders erstaunlich ist, dass die Zentren für Emotionen, Musik und Sinneseindrücke oft länger erhalten bleiben als die für Sprache oder logisches Denken. Deshalb kann ein vertrautes Lied noch immer ein sanftes Lächeln hervorrufen, auch wenn der Text längst vergessen ist. Oder der Geruch eines Lieblingsessens weckt nach wie vor ein Gefühl von innerer Geborgenheit, selbst wenn die Person nicht mehr benennen kann, was sie isst.
Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass emotionale Reaktionen erstaunlich lange stabil bleiben, auch noch in späten Stadien der Demenz. Dies zeigt, dass der Mensch per se nicht verschwindet, wenn seine Erinnerungen verblassen, sondern dass er weiterhin fähig bleibt, Nähe, Liebe und Zuwendung zu empfinden. Und dementsprechend wichtig ist es darauf zu achten den Betroffenen, diese Geschenke zu machen und für sie da zu sein.
Neue Kommunikation entsteht
Für Angehörige bedeutet das jedoch eine sehr ambivalente und emotional enorm herausfordernde Erfahrung. Da ist auf der einen Seite die große Trauer, wenn die eigene Mutter den Namen ihrer Kinder nicht mehr weiß und die massive Unsicherheit, wenn der eigene Partner plötzlich nicht mehr erkennt, dass er seit Jahrzehnten verheiratet ist. All diese Momente sind unglaublich schmerzhaft und fühlen sich für die eigene gesunde Umgebung immer wieder wie kleine Abschiede und große Kränkungen an. Gleichzeitig eröffnet sich daraus aber auch ein ganz neuer und wertvoller Zugang, aus dem eine neue Form von Kommunikation resultieren kann. Nämlich eine Kommunikation über liebevolle Berührungen, über schöne Musik und über einfache gemeinsame Rituale, die beiden Seiten zugleich auch eine neue Struktur des Zusammenseins geben können.
Wissenschaftlich spricht man hier von einer sogenannten „nonverbalen Resonanz“. Sie ist ein besonders wertvoller Schlüssel, um Menschen mit Demenz emotional zu erreichen, auch wenn Worte nicht mehr tragen.
Angehörige berichten häufig, dass eine der größten Herausforderungen war, lernen zu müssen, ihre eigenen Erwartungen loszulassen. Denn statt in jeder Begegnung wieder voller Hoffnung nach dem „früheren Menschen“ zu suchen, geht es dann darum, im „Hier und Jetzt“ zusammen zu sein und zuzulassen, dass der eigene Vater sich plötzlich, wie ein Kind über einen Schmetterling freuen kann und dabei den Namen seines eigenen Kindes vergisst. Eine Großmutter, die bei einem alten Volkslied mit ihrer sichtbaren Freude den ganzen Raum zum Mitsingen bringt, ohne selbst den Text zu kennen. Solche Momente sind für alle Seiten immer ganz besonders kostbar und bilden kleine wertvolle Inseln des gemeinsamen Glücks im Meer des Vergessens.
Hilflosigkeit und Aggression bei Angehörigen
Gleichzeitig darf man diese schwere Krankheit natürlich nicht romantisieren. Denn eine Demenz ist immer auch eine enorm schwere Belastung, an der man als Angehöriger denkt zu zerbrechen. Sie bringt Unruhe, Verwirrung und ob der enormen Hilflosigkeit manchmal auch Aggressionen mit sich. Deshalb stehen pflegende Angehörige selbst häufig unter massivem Stress und neigen zu Depressionen und körperlichen Erschöpfungszuständen. Deshalb ist es so entscheidend, dass unsere Gesellschaft und ebenso die Politik Strukturen schaffen, die Betroffene und ihre Familien mit diesem Schicksal nicht alleine lassen. Sei es durch ambulante Hilfen, Tagespflegeangebote oder eine professionelle Beratung und Hilfestellung. Denn eine Demenz ist keine private Tragödie, die nur wenigen Familien passiert, sondern vielmehr eine der größten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit.
Zwischen Wissenschaft und Menschlichkeit – Wege zu einem würdevollen Umgang
In den letzten Jahren hat die Forschung auch bereits großartige Fortschritte gemacht. Neue Medikamente wie beispielsweise Lecanemab, die gezielt auf krankhafte Eiweißablagerungen im Gehirn wirken, geben Hoffnung, das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit mittlerweile zumindest zu verlangsamen. Auch Lebensstilfaktoren spielen dabei eine große Rolle. Regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, geistige Aktivitäten und soziale Kontakte können das Risiko einer Demenz senken oder den Verlauf günstig beeinflussen. Die sogenannte FINGER-Studie aus Finnland zeigte dabei besonders eindrucksvoll, dass ein multimodales Programm aus körperlichem Training, einer bewussten Ernährungsumstellung und ein regelmäßiges kognitives Training die geistige Leistungsfähigkeit älterer Menschen stabilisieren kann.
Bevormundung vermeiden
Doch trotz aller Fortschritte bleibt leider die Realität, dass es bisher keine Heilung gibt. Und genau hier beginnt nun die zweite, mindestens ebenso wichtige Ebene in Bezug auf diese Krankheit. Nämlich der Umgang damit im Alltag. Wissenschaftlich lässt sich hierbei klar belegen, dass die Lebensqualität von Menschen mit Demenz weniger von der Schwere der kognitiven Einschränkungen abhängt als von der Haltung ihrer Umgebung. Werden sie ernst genommen, in ihrer Persönlichkeit respektiert und liebevoll begleitet, fühlen sie sich sicherer und zufriedener. Werden sie hingegen bevormundet, übersehen oder gar isoliert, verstärken sich ihre Symptome wie Verwirrung, Angst und Unruhe zusehends und die Krankheit wird immer schlimmer und schreitet schneller voran.
Personenzentrierte Pflege
Hier kommt nun der Begriff der „Personenzentrierten Pflege“ ins Spiel, der von dem Psychologen Tom Kitwood geprägt wurde. Er betont dabei, dass Demenz nicht nur ein medizinisches, sondern vor allen Dingen auch ein zwischenmenschliches Phänomen ist. Denn Menschen mit Demenz behalten ihre Identität, ihre Würde und ihre Bedürfnisse, auch wenn sie diese selbst nicht mehr klar äußern können. Die Aufgabe der Angehörigen und Pflegekräfte ist es deshalb, zu versuchen diese Bedürfnisse möglichst zu erspüren und sie ernst zu nehmen. Das bedeutet in der Praxis viel Geduld zu haben, sich auf Wiederholungen einzulassen, Rituale liebevoll zu pflegen und kleine Erfolge gemeinsam zu feiern. Und vor allem bedeutet es, den Menschen nicht auf seine Defizite zu reduzieren, sondern auf das zu schauen, was er noch kann. Und dieses Können bewusst und behutsam zu fördern und dem Betroffenen dadurch dabei zu helfen seine Eigenständigkeit auf einzelnen Ebenen möglichst lange zu erhalten.
In der Praxis bedeutet das Räume zu schaffen, die die Orientierung erleichtern, klare Strukturen einzuführen, verständliche Symbole und vertraute Farben zu nutzen. Und Rituale zu nutzen wie das Einsetzen von Musik, an die die Betroffenen schöne Erinnerungen haben, schöne Erinnerungsstücke bereitzuhalten, die auch zur Beruhigung beitragen können und täglich vertraute Abläufe zu pflegen. Und es heißt auch, sich in der Familie gegenseitig zu unterstützen und Angehörige zu entlasten, ihnen Atempausen zu geben, und ihnen zu helfen ihre eigene Kraft zu behalten.
Dr. Sabine V. Schneider