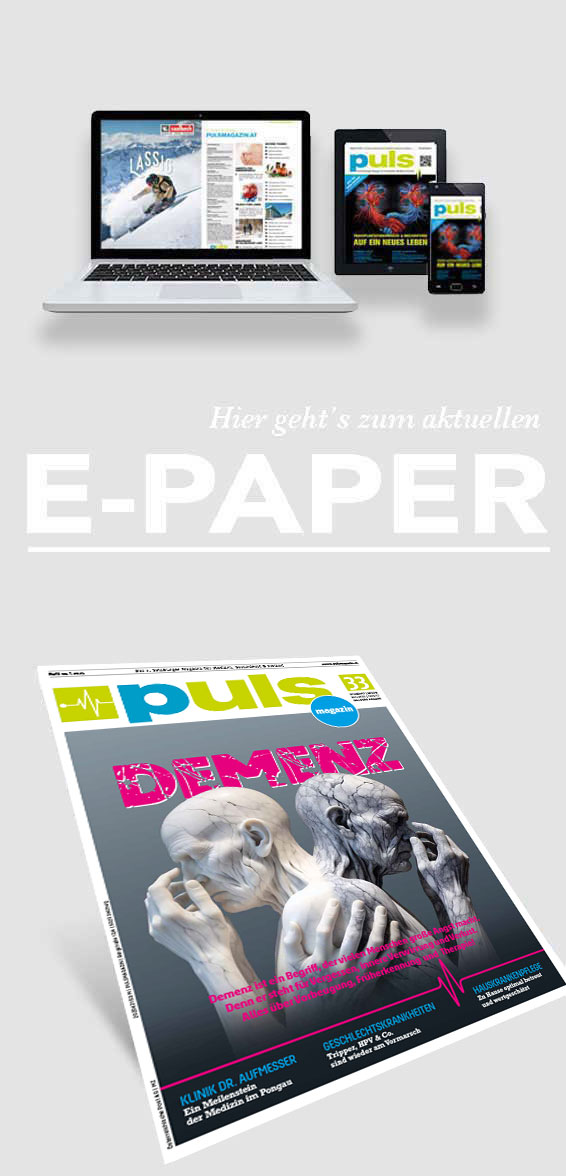Der Begriff Demenz beschreibt ein klinisches Syndrom, das durch den erworbenen andauernden Verlust höherer Hirnleistungen definiert ist. Der meist progrediente Verlauf resultiert in einer Beeinträchtigung von Alltagsfähigkeiten und Selbstständigkeit. Die Ursachen von Demenzen sind zumeist degenerativ degenerative (Alzheimer-Erkrankung, Lewy-Body-Erkrankung, u.a.), auch Durchblutungsstörungen spielen eine Rolle (vaskuläre Demenz). Die Alzheimer-Erkrankung ist mit etwa 60-70 % die häufigste Demenz. Mit dem Älterwerden verändert sich unser Körper – und auch unser Gehirn. Doch das bedeutet nicht, dass wir dem geistigen Abbau hilflos ausgeliefert sind. Die gute Nachricht: Viele Faktoren, die für die Gehirngesundheit wichtig sind, können wir beeinflussen.
Kognitive Reserve – unser Schutzschild
Eine wesentliche Rolle in der Prävention von Demenz-Erkrankungen spielt die kognitive Reserve. Darunter versteht man die Fähigkeit des Gehirns, Schäden zu tolerieren, die durch Alterung, Alzheimer-Erkrankung oder andere Ursachen von Demenz entstehen. Je höher die kognitive Reserve, desto geringer ist das Risiko, dass eine Person bei Vorliegen einer neuropathologischen Schädigung klinische Symptome einer Demenz entwickelt. Die kognitive Reserve wird durch geistig stimulierende und soziale Aktivitäten gestärkt. Diese Aktivitäten müssen allerdings lebenslang aufrecht erhalten werden, um eine kognitive Reserve für die gesamte Lebensspanne aufzubauen. In jungen Jahren trägt eine qualitätsvolle Ausbildung zu einer hohen kognitiven Reserve bei.
Traditionellen Risikofaktoren
Traditionelle Risikofaktoren deren Rolle für Herzinfarkt und Schlaganfall gut belegt ist, kommt auch in Hinblick auf Demenz-Erkrankungen eine hohe Bedeutung zu. Leitlinien ermöglichen eine an Zielwerten orientierte Therapie.
Bluthochdruck kann kleine Gefäße im Gehirn schädigen und das Risiko für Alzheimer und vaskuläre Demenz erhöhen. Für das mittlere Lebensalter wissen wir, dass ein systolischer Blutdruck von >130mm Hg das relative Risiko für eine kognitive Leistungsminderung um etwa 20% erhöht. Durch eine konsequente Behandlung kann dieses Risiko deutlich gesenkt werden
Unter den Herzerkrankungen ist das Vorhof-Flimmern besonders hervorzuheben, welches eine Erhöhung des Demenz-Risikos um ca. 30% bedingt. Dieses Risiko kann durch orale Antikoagulation („Blutverdünnung“) um 60% gesenkt werden. Vorhofflimmern betrifft bis zu 15% der 80-Jährigen.
Typ-II-Diabetes führt zu einer Erhöhung des Demenz-Risikos um bis zu 60%. Eine konsequente Stoffwechselkontrolle ist daher auch unter dem Aspekt der Gehirngesundheit sinnvoll. Das Vermeiden von Hypoglykämie („Unterzucker“) kann das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Demenz reduzieren.
Lange Zeit war der Zusammenhang zwischen erhöhten Blutfetten und Demenzrisiko unklar. Neue Studien legen nahe, dass eine Therapie eher zu einer Risikoreduktion für Alzheimer- und Demenzerkrankungen beiträgt.
Lebensstil zählt
Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität senkt das Demenzrisiko um bis zu 28%. Bewegung fördert nachweislich u.a. die Bildung von neuen Nervenzellen und Verbindungen („Synapsen“) im Gehirn.
Ernährung: Verschiedene Ernährungsformen (Mediterrane Ernährung, DASH- und MIND-Diät) zeigen positive Effekte auf das Demenz-Risiko.
Besonders gut belegt sind die Effekte der mediterranen Ernährung: Dieses Konzept orientiert sich an den traditionellen Essgewohnheiten der Menschen in Südeuropa (Italien, Griechenland und Spanien). Sie gilt als eine der gesündesten Ernährungsformen weltweit und wird oft mit einem längeren Leben und einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenz in Verbindung gebracht. Die Basis bilden reichlich pflanzliche Lebensmittel – wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukte (Brot, brauner Reis), Nüsse und Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Bohnen). Olivenöl dient als primäre Fettquelle. Milchprodukte wie Naturkäse und Joghurt landen täglich in geringen bis mittleren Mengen auf dem Teller. Fisch und Geflügel werden mehrmals pro Woche in geringen bis mittleren Mengen aufgetischt, rotes Fleisch hingegen selten. Statt Süßigkeiten wird zum Nachtisch Obst gereicht – Süßes mit Zuckerzusatz findet man nur selten auf dem Speiseplan, ebenso wie zuckerhaltige Getränke.
Rauchen und Alkohol: Rauchen erhöht das Demenzrisiko Dosis-abhängig deutlich. Alkohol in kleinen Mengen scheint nicht schädlich zu sein, größere Mengen erhöhen das Demenz-Risiko und beschleunigen den Verlauf von Demenz-Erkrankungen.
Soziale Kontakte: Einsamkeit erhöht das Risiko für geistigen Abbau und Demenz um etwa 25%. Das Vermitteln von Sozialkontakten („social prescribing“) stellt eine Interventionsmöglichkeit dar. Hörprobleme können soziale Isolation fördern – eine zeitgerechte Versorgung mit Hörgeräten stellt eine wirksame Intervention dar.
Schlaf: Guter Nachtschlaf unterstützt das „Reinigungssystem“ des Gehirns, das schädliche Stoffe abbaut und trägt damit zu einer Reduktion des Demenz-Risikos bei.
Gehirngesundheit ist kein Zufall. Wer auf seinen Lebensstil achtet, körperliche Erkrankungen gut behandelt und geistig sowie sozial aktiv bleibt, kann viel dafür tun, auch im hohen Alter klar und fit im Kopf zu bleiben. Stellt sich dennoch der Verdacht auf geistigen Abbau, ist es wichtig, Demenz-Symptome von „normaler“ Altersvergesslichkeit abzugrenzen.
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Iglseder